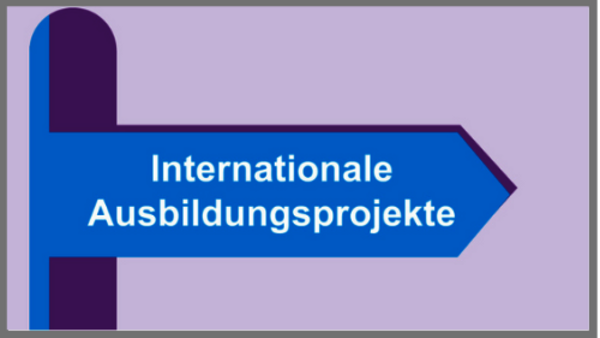Internationale Diakonie
Die Diakonie Württemberg ist Landesstelle für die internationalen Hilfswerke der Diakonie - Brot für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe und Hoffnung für Osteuropa. Sie unterstützt, zusammen mit Projektpartnern vor Ort, Hilfemaßnahmen. Mit Bildungsprojekten und Aktionen wie Faire Gemeinde oder einem internationalen Ausbildungsprojekt engagiert und vernetzt sich die Diakonie Württemberg auch hierzulande.