„Herbst der Reformen“ – ja, aber nicht auf Kosten von armen Menschen
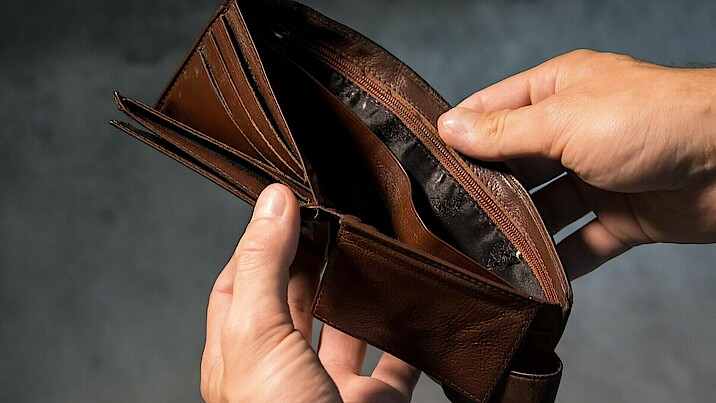
Wer Bürgergeld bezieht, braucht Begleitung vor Sanktionen
Die Bundesregierung hat einen „Herbst der Reformen“ angekündigt. Die Diakonie Württemberg begrüßt alle Reformen, die eine Stabilisierung bewirken, warnt aber vor Einschnitten bei Sozialleistungen.
„Menschen, die auf Bürgergeld angewiesen sind, brauchen eine kluge und angemessene Unterstützung beim Weg aus der Armut.“, sagen Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, und Tanja Herbrik, Vorsitzende des Fachverbands Arbeitslosenhilfe in der Diakonie Württemberg.
Als Grundproblem nennen sie den für viele Menschen zu teuren Wohnraum und zu wenige Sozialwohnungen. „Die jetzt angedachte Pauschalierung der Kosten der Unterkunft verursachen neue Obdachlosigkeit in großem Ausmaß. Mietendeckel und ein Sofortprogramm für den sozialen Wohnungsbau sind hier die notwendigen Lösungsansätze.“ Wenn man Mietkosten einsparen wolle, dürfe das nicht von den ohnehin knapp bemessenen Leistungen für Essen und täglichen Bedarf abgezogen werden. Bürgergeldempfänger und -empfängerinnen könnten auch nicht einfach die Wohnung wechseln, weil häufig gar keine günstigere Wohnung gefunden werden kann. Hier drohe am Ende Obdachlosigkeit, auch für ganze Familien.
Das sei auch deshalb problematisch, weil Menschen, die einmal in Notunterkünften und Obdachlosenheime untergekommen sind, schwerer wieder Fuß fassen im Alltagsleben und bei der Arbeit.
Herr F. lebt in einer Notunterkunft der Kommune, versucht seinen Alltag in den Griff zu bekommen. Das Jobcenter vermittelt ihm eine Beschäftigung bei einem diakonischen Arbeitshilfeträger. Durch unterstützte Beschäftigung und intensive Betreuung fasst er Fuß und stabilisiert sich. Die schwierige Unterkunftssituation mit anderen in einem Zimmer führt immer wieder dazu, dass er zu spät zur Arbeit kommt. Eine stabile und sichere Unterkunft wäre der Schlüssel zu Integration und Unabhängigkeit. Als Wohnungsloser ist er auf dem prekären Wohnungsmarkt jedoch deutlich benachteiligt, was die dauerhafte Integration schwierig macht.
Um Menschen in Arbeit zu bringen, insbesondere Langzeitarbeitslose, brauchen diese Begleitung. Das zeigen auch neuere Studien. Beschäftigungsprogramme bei Arbeitshilfeträgern der Diakonie und anderer Wohlfahrtsverbände sind wirksam. „Die Teilhabebeschäftigung hat sich als Instrument etabliert, nur wird sie aus Mangel an Geld in den Jobcentern kaum noch angewandt“, stellen Noller und Herbrik fest. „Begleitung, Beschäftigung und Qualifizierung statt Wiedereinführung von Vermittlungsvorrang und Sanktionen – so finden viele Erwerbslose dauerhaft den Weg zurück in die Arbeitswelt. Ein beeinträchtigter Mensch, der unter Androhung von Entzug seiner materiellen Existenz in prekäre Arbeit geschickt wird, verliert diese erfahrungsgemäß schnell wieder.“
Herr H. tut sich schwer mit dem Anschluss an die Arbeitswelt. Zu Beginn steht eine Arbeitsgelegenheit zum Aufbau von Tagesstruktur durch Beschäftigung. Mit erreichter Stabilisierung kommt der Übergang in eine Teilhabebeschäftigung mit Kompetenzanalyse zur beruflichen Orientierung. Über ein Praktikum kann dann der Übergang in Qualifizierung oder Ausbildung zum Beispiel im Pflegebereich gelingen. Mit dem Qualifizierungsabschluss erfolgt die nachhaltige Eingliederung in Arbeit.
Die Diakonie wirbt für einen massiven Ausbau der Beschäftigung bei den Wohlfahrtsverbänden: Tätigkeiten in den Kommunen und im Umweltschutz oder im Recycling sind gemeinnützig und im gesellschaftlichen Interesse. Langzeitarbeitslose Menschen sind hier gut einsetzbar. „Diese Menschen sind keine Totalverweigerer. Sie haben vor allem Angst vor dem erneuten Versagen im Job und der materiellen Unsicherheit. Sie brauchen angemessene Hilfe und Begleitung“, sind sich Annette Noller und Tanja Herbrik einig.
Frau T. engagiert sich ehrenamtlich in einer diakonischen Tafel und ist tief verunsichert von der aktuellen politischen Diskussion. Sie hat Angst vor dem, was ihr zukünftig abverlangt werden könnte. Sie ist gesundheitlich stark eingeschränkt und hat nicht mehr die Leistungsfähigkeit für eine Vollzeittätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Sie hat Angst um ihre Existenzgrundlage.
Noller und Herbrik betonen gemeinsam: Die derzeitigen Debatten wirken tief verstörend auf Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, weil sie aufgrund von Erkrankung oder anderen gravierenden Einschränkungen nicht mehr die Leistung einer vollen Beschäftigung erbringen können. Viele Menschen, die Bürgergeld erhalten, müssen auch aufstocken, weil sie mit ihrer regulären Arbeit nicht mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten können. „Dass gerade diese Menschen als Einsparziele in den Blick genommen werden, ist beschämend“, sagen die Vorstandsvorsitzende und die Vorsitzende des Fachverbands Arbeitslosenhilfe gemeinsam.
